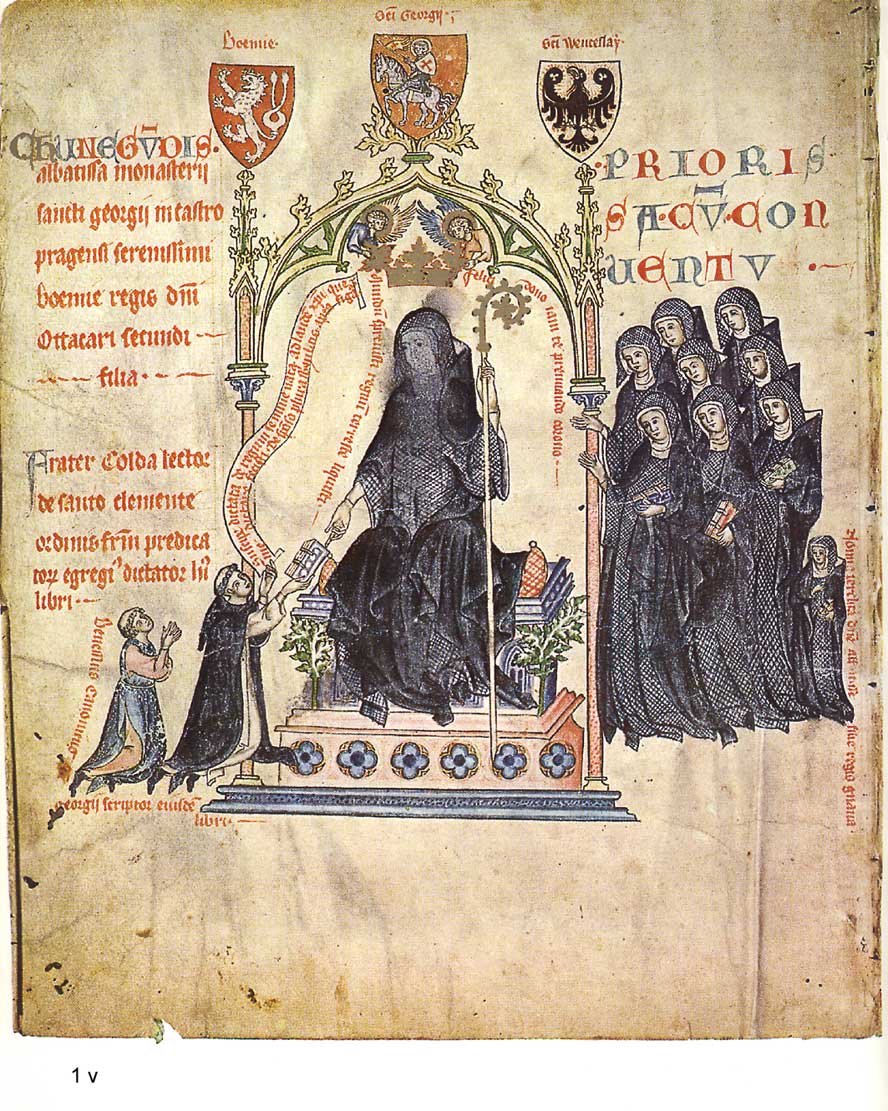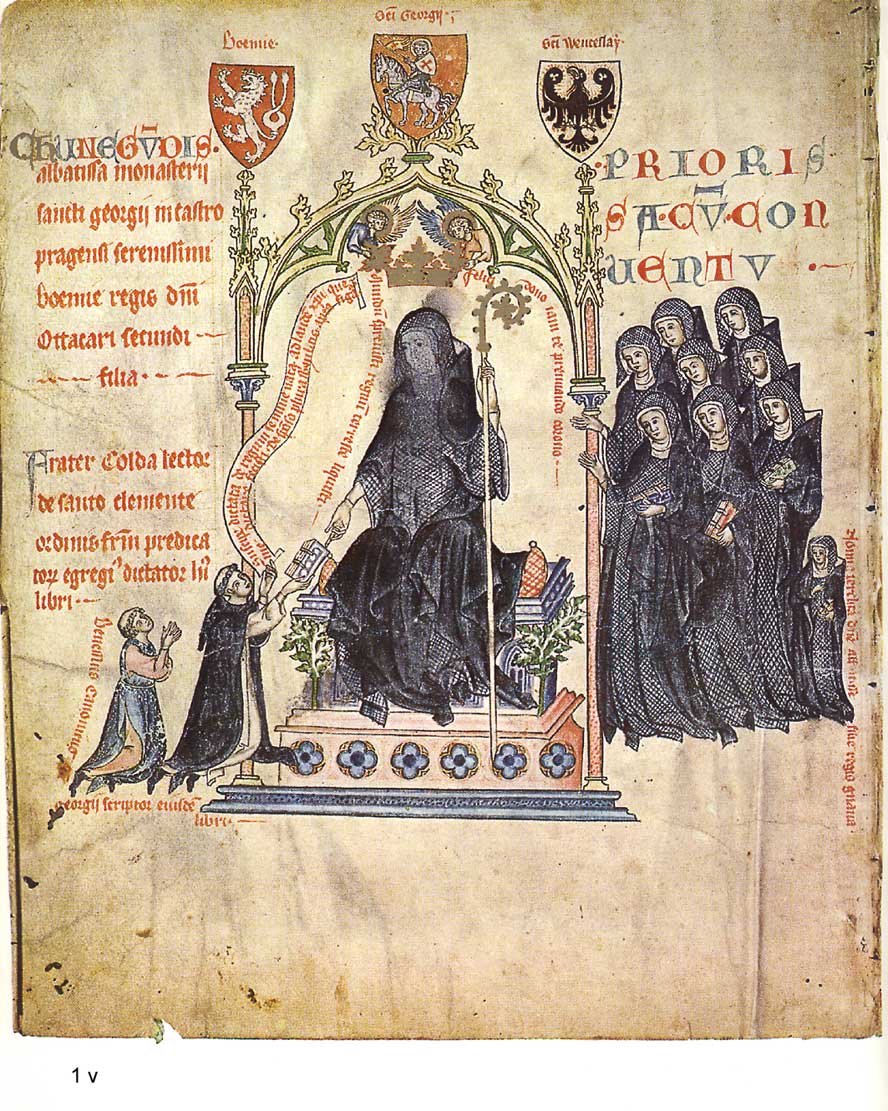
Würdigung und Danksagung
Auf Vorschlag der Joachim Jungius-Gesellschaft
der Wissenschaften verleiht die
DR. HELMUT UND HANNELORE GREVE STIFTUNG
FÜR WISSENSCHAFTEN UND KULTUR
den Förderpreis an
Frau Dr. phil. Maren-Gia Toussaint
Kunstgeschichtliches Seminar, Universität
Hamburg
Die Frage, wie Bilder die Ideenwelt der Menschen formen, wird heute bei der Allgegenwart der Bildmedien häufig gestellt; dass sie einen ertragreichen Zugang auch zur Erforschung der Kultur des Mittelalters eröffnet, hat Dr. Maren-Gia Toussaint beispielhaft vorgeführt. In ihrer Dissertation konnte sie zeigen, wie das Andachtsbuch der böhmischen Prinzessin Kunigunde durch die kalkulierte Kombination von Lektüre, Bildbetrachtung und Meditation zu einer religiös aufgeladenen Lebensführung anleitet, bei der sich höfischer Anspruch mit klösterlicher Demut und Frömmigkeit verbindet. In der exemplarischen Zusammenführung von Methoden und Gegenständen der Kunst- und Frömmigkeitsgeschichte gelang damit zugleich die umfassende Rekonstruktion einer mittelalterlichen Lebens- und Vorstellungswelt.
Hamburg, am 21. November 2003
(Prof. Dr. Helmut Greve)
(Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve)
Stiftungsvorstand
Danksagung von Dr. Maren-Gia Toussaint
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrtes Ehepaar Greve, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Es erfüllt mich mit großer Freude
und Dankbarkeit jenem kleinen Kreise anzugehören, der heute
den Förderpreis der Dr. Helmut und Hannelore Greve Stiftung
für Wissenschaften und Kultur entgegennehmen darf. Die Verleihung
dieses Preises beruht auf der Initiative einiger Menschen, denen
ich an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte. Als
Stiftern gilt mein Dank zunächst Ihnen, verehrtes Ehepaar
Greve, sowie dem Vorstand der Joachim Jungius-Gesellschaft, namentlich
Herrn Professor Dr. Heimo Reinitzer, der meine Arbeit für
die Auszeichnung vorgeschlagen hat. Besonders danken möchte
ich auch meinem akademischen Lehrer und Doktorvater, Herrn Professor
Dr. Bruno Reudenbach, ohne dessen wohlwollende Unterstützung
und Förderung ich heute nicht hier stünde.
Doch ist noch eine weitere Person am Gelingen des Werkes nicht
ganz unbeteiligt. Gemeint ist Kunigunde von Böhmen (1256-1321),
Prinzessin und Äbtissin des St. Georgsklosters zu Prag, die
Sie hier in der Mitte des Dias (s.u.) sehen. Ein für diese
vornehme Dame um 1312 bis 1316 individuell gestalteter Codex,
das sogenannte Kunigundenpassional, stand im Mittelpunkt meiner
Untersuchung. Die mit äußerst qualitätvollen Federzeichnungen
illuminierte lateinische Handschrift wird in der gezeigten Dedikationsszene
vom Verfasser der Texte, dem Dominikaner Colda - unten links kniend
-, an die Auftraggeberin übergeben. Eindrucksvoll spiegeln
die Texte und Bilder dieser Handschrift eine Welt zwischen Hof
und Kloster, weltlicher und geistlicher Macht. Die weltliche Seite
ist in dem Bild, das die Äbtissin mitsamt ihren Chorfrauen
zeigt, nur am oberen und am seitlichen Bildrand erkennbar. Oben
durch die eindrucksvolle Heraldik und am rechten Rand, etwas versteckt,
durch die Zwergin, die Kunigunde aus ihrem Hofleben ins Kloster
mitgenommen und kurzerhand als Nonne eingekleidet hat.
Als Beichtvater und Seelenführer der hochadligen Äbtissin
weist Colda ihr den Weg zur Heiligkeit, um sie gleichzeitig als
Heilige zu stilisieren. Wie das Bild zeigt, erhält Kunigunde
die Krone des ewigen Lebens bereits zu Lebzeiten - ein Vorgang,
der vor dem Hintergrund der damals geläufigen Vorstellung
von Geblütsheiligkeit verständlich ist.
Doch bedurfte es nicht nur der Abstammung aus einem sich selbst
als sacra stirps begreifenden Königshaus, um des himmlischen
Lohnes teilhaftig zu werden. Neben guten Werken sollte auch die
Seele rein, d.h. den Anfechtungen des Bösen gewachsen sein.
Colda schildert das irdische Leben als Kampf, die menschliche
Seele als Schlachtfeld. Um in diesem Kampf gegen den Widersacher
zu bestehen, wird Kunigunde ein ganzes Arsenal geistlicher Waffen
empfohlen, die sogenannten arma Christi - jene Werkzeuge, durch
die Christus die Passion erlitt, wie Geißel, Lanze und Kreuz.
Ausführlich in Wort und Bild vorgestellt, propagiert Colda
den steten spirituellen Gebrauch jener Waffen zur Reinigung der
Seele und zur Vorbereitung auf den künftigen himmlischen
Wohnort, der ebenfalls in allen Details geschildert wird.
Neben der Anleitung zum Gewinn himmlischen Heils, die als Quelle
weiblicher Spiritualität einen selbständigen Platz beanspruchen
dürfen, läßt die spezielle Gestaltung des Text-Bild-Verhältnisses
neue Erkenntnisse über die Rezeption von Andachtsbild und
Andachtstext zu. Beim Lesen und Betrachten der Handschrift wendet
sich der Blick sowohl auf deren Bilder als auch ins Innere der
Seele. Dabei kommt den inneren, oft über den Text gesteuerten
Bildern hohe Bedeutung zu. Seelische Imaginationen können
mit den Illustrationen in eine Wechselbeziehung treten, so daß
sich der Rezipientin weitere Bildwelten erschließen, innerhalb
derer die Grenzen der Realität aufgehoben werden und das
bildhafte Gestalt annehmende Transzendente in die Wirklichkeit
einbricht. Auf diese Weise öffnet sich ein Weg, biblische
Heilsereignisse nicht nur zu memorieren, sondern auch aktuell
bildhaft zu erleben.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!